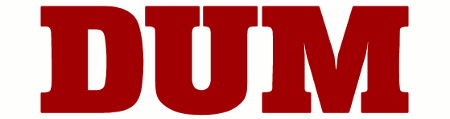Erika Kronabitter sucht die Langeweile und findet Projekte sonder Zahl. Sie braucht bloß einen freien Blick auf Wellen und Möwen und schon fliegen die Gedanken. Zum Schreiben sitzt sie am liebsten inmitten von Texten und in Zügen, die ankommen. Entgleisen lässt sie lieber Sätze. Markus Köhle hat über den Jahreswechsel hinweg Fragen und Antworten mit ihr ausgetauscht.
Liebe Erika, du hast gerade wieder sehr erfolgreich den Lyrikpreis Feldkirch abgewickelt. Wie lange machst du das schon?
Den Feldkircher Lyrikpreis gibt's nun schon 21 Jahre - vorbereitet im Jahr 2002 im Sternzeichen der großen Wagnisse, als Impulsgeber seit 2003 Jahr für Jahr immer wieder aufs Neue ein Lichtblick in den dunklen Alltagsschluchten. Ein Sommerwind mit Höhenflügen - und das Ende November.
Was ist dir dabei besonders wichtig?
Das Lyrikpreiswochenende ist ein Fest der Poesie, soll ein Festival sein, in welchem die Lyrik im Mittelpunkt steht und die mit ihr "verbandelten" Künste.
Im "Davor" ist es mir seit der 1. Preisverleihung besonders wichtig, dass die Einsendungen anonymisiert an die Jury gehen, damit der Bewertungsfokus auf den Texten und nicht auf den Namen bekannter Autor:innen liegt.
Was ist diesmal ganz besonders gut gelungen?
2023 gab es auch im Vorfeld ein hochwertiges Lyrikprogramm: "Radio Rosa", initiiert von Patricia Brooks, und das "Chlebnikow-Projekt" am Freitag waren so ungewöhnlich wie unbekannt und umrahmten die große "Lyrik-Gala" ebenso wie die Sonntagsmatinee mit "habe bewurzelte Stecklinge" (ein Anthologieprojekt, hg. von Raoul Eisele und Lea Menges). Das Klanglabor Liechtenstein spielt bei der Preisverleihung übrigens nicht nur irgendwelche Begleitmusik, sondern setzt zu den Lesungen der Preisträgerinnen musikalische Poeme, die auf die Lyrik der Preisträger:innen eingehen.
Was wünschst du dir für die Zukunft des Feldkircher Lyrikpreises?
Wie wär's mit einem Jubiläum "100 Jahre Feldkircher Lyrikpreis"? Eines der am 1. Jänner Neugeborenen könnte in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren auserwählt werden, die poetische Idee des Feldkircher Lyrikpreises weiter zu tragen. Vielleicht gibt es dann auch einen Sonderpreis für eine Lesung auf einer Raumstation mit Weltübertragung - die Kulturabteilung des ORF Vorarlberg hat es in den 21 Jahren nie geschafft, mal selbst für eine Übertragung der Veranstaltung vorbei zu kommen.
Es gab diesmal die Anthologie schon vorab. Was war der Hintergedanke dabei?
Es gab keinen Hintergedanken, eher war es ein Übergedanke: Mit der edition V, welche zum ersten Mal eine Lyrik-Anthologie herausbringt (soviel ich weiß, überhaupt zum ersten Mal Lyrik veröffentlicht), also eine Überschreitung der Genres innerhalb des Verlags gewagt hat, gibt es auch neue Überlegungen, was den besten Zeitpunkt betrifft. Mit dem Buch gleich nach Fertigstellung an die Öffentlichkeit zu gehen, ein Buch, das übrigens ein grandioses Cover aufzuweisen hat, gab's neue Werbestrategien.
Welche anderen Projekte treiben dich sonst grad rum und um?
Die Suche nach der Langeweile. Das ist mein Hauptprojekt. Daneben arbeite ich in gewisser Weise, das Übliche, das viele Schriftsteller:innen machen, flanieren, suchen, sammeln, sich inspirieren, sitzen, denken, schreiben, streichen, schreiben ... Damit bin ich sehr beschäftigt: Im Frühling erscheint mein neuer Lyrikband "Delfine vor Venedig", Ende 2024 vielleicht wird mein Roman mit dem Arbeitstitel TOPIE fertig (werde das nextgenerationexperts-Chat GPT um eine Prognose bitten) ...
Gehe ich richtig in der Annahme, dass darin Räume und Orte eine zentrale Rolle spielen?
In "Topie" (Arbeitstitel) geht es um Zustände. Um die gesellschaftlichen Zustände, um das Thema Gewalt und Vergewaltigung. "... hätte nie so weit kommen dürfen. Doch wer bestimmt, wie weit etwas gehen darf? Wer verhindert? Wer hätte die Fähigkeit, zu verhindern? Den Mut?" Es geht um das Beenden von Zuständen.
Welche Bedeutung haben Räume und Orte für dein Schreiben?
Grundsätzlich habe ich im Laufe meines Schreiblebens entdeckt, dass mein Schreibraum einen hellen Blick nach vor, in die Weite aufweisen muss. Irgendwo dort draußen über dem See, bei den Wellen und Möwen. Dabei muss mein Schreibplatz nicht groß sein, kein wuchtiges breites Teil, auf dem sich fein säuberlich geordnet die Lektüre und Recherchematerial stapelt. Mir genügt ein kleines Glastischchen, rings herum Bücher, links auf dem Beistelltischchen schriftliche Unterlagen, rechts auf dem kleinen Schreibsofa verstreute Büchertürmchen, thematische Häufchen, griffbereit. Sitze sozusagen mitten in den Texten.
Können Orte in Bewegung sein?
Das ist eine gute Frage. Einerseits bleiben Städte, Gebirge, Flüsse und andere geografische Merkmale in der Regel an einem Ort. Scheinbar. In Wirklichkeit ist alles in Bewegung, unmerklich, aber in Bewegung. Es gibt nichts, das nicht in Bewegung ist. Ein aufsehenerregendes Beispiel von "Ort in Bewegung" ist Felbers schiefes Haus in Sibratsgfäll. Hier sind ganze Häuser, Ferienhütten und die Kirche einfach ganz gemütlich den Hang hinuntergerutscht. Mitsamt des darunterliegenden Erdreichs. Das ehemalige Felber-Ferienhaus hat sich bei dieser Rutschung ohne nennenswerte Schäden insgesamt 18 Meter bewegt und steht jetzt einfach auf einer anderen Grundparzelle.
Andererseits bietet der zuvor beschriebene Schreibraum trotz seiner begrenzten physischen Größe einen reichen geistigen Denkblickraum. Der Blick auf den See, die Wellen und Möwen, schaffen eine inspirierende Atmosphäre für die kreative Arbeit. In einem metaphorischen Sinn könnte man sagen, dass der Schreibort durch die Weite des Sees und die Dynamik der Elemente "in Bewegung" ist. Die ständig wechselnden Wellen, die vorbeiziehenden Möwen und das sich verändernde Licht dienen als Quelle ständiger Inspiration, die dem Schreibraum eine Bewegung verleiht bzw. in Bewegung setzt.
Sind dir Züge Büros auf Schiene?
Derzeit erstreckt sich meine Wohnung vom Schreibort West am Bodensee zum Schreibort Ost in Wien. Dazwischen befindet sich mein Büro, mein rollendes Büro. "Büro auf Schiene" stellt die neue Art eines mobilen Arbeitsplatzes dar. In den letzten Jahren hat sich der Trend, in Zügen zu arbeiten verstärkt, WLAN ermöglicht den Fahrgästen, während der Zugfahrt E-Mails zu beantworten oder andere berufliche Aufgaben zu erledigen. Diese Art der Nutzung von Zugreisen ist besonders in Ländern mit gut ausgebautem Schienennetz und effizienten Bahnverbindungen verbreitet. ... Leider aber gibt es seit einiger Zeit durch Managementversagen in Deutschland und Österreich massive Komfort- und Pünktlichkeitseinbrüche.
Würdest du dich als Dichterin on the railroad bezeichnen?
Unbedingt! Das ist ein schönes Bild, das du da entwirfst. - Am kreativsten bin ich, wenn ich fahre. Dann, wenn die Gedanken sich nicht festhalten müssen, sondern im freien Raum vor sich dahinbaumeln. Kreuz und quer herumfahren.
Lässt du Texte gelegentlich gezielt entgleisen?
Nichts anderes ist assoziatives bzw. experimentelles, kreatives Schreiben. Die Sätze nicht in eine Normschachtel, nicht in einen Sarg packen, aus dem sie sich nicht mehr befreien können und in dem sie sich nicht entfalten können. Den Text gegen den Strich bürsten, wie Friederike Mayröcker sagte. Wie wir wissen, hat es diese "gegen den Strich gebürstete" Literatur schwer. Kürzlich habe ich eine Videoaufnahme, welche ich vor 20 Jahren gemacht habe, angesehen. Ilse Kilic, Fritz Widhalm und anderen KollegInnen diskutieren im Theater am Saumarkt über experimentelle Literatur und warum das Publikum sich nicht für diese Art von Literatur öffnet. Die Erkenntnisse können 1:1 auf heute übertragen werden. Wenn man die FB-Kommentare zu den Eröffnungsperformances Kulturhauptstadt 2024 liest, kann einem übel werden! Ein Großteil der Menschen hat keine Ahnung von Gegenwartskunst. Es heißt also, dran zu bleiben: Spielen wir mit der Sprache, zerpflücken wir die Worte, ja, lassen wir die Texte entgleisen!
Danke für das Interview!
< zurück